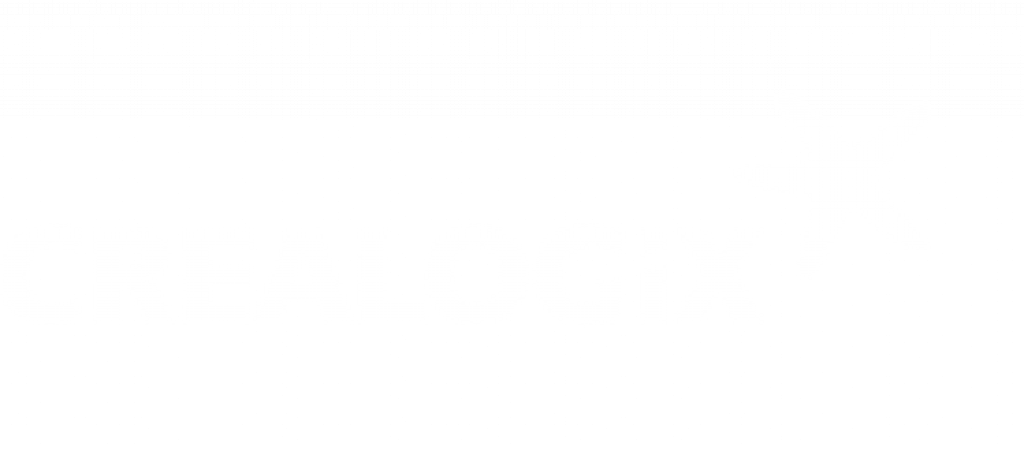Das EY Bankenbarometer zeichnet ein differenziertes Stimmungsbild der Schweizer Bankenlandschaft. Sowohl die äusseren Rahmenbedingungen, die etwa in Form niedriger Zinsen und Volatilitäten auf die Erträge drücken, als auch der Wandel der Finanzindustrie selbst zwingen die Institute dazu, ihre Geschäftsmodelle und Strategien zu überdenken. Viele sehen in einer neuen Konzentration auf den Kunden und sein Erleben die Möglichkeit, ihre Ergebnisse mittelfristig zu verbessern.
Fast 90 Prozent der von EY im Rahmen des Bankenmonitors 2020 Befragten meinen, dass sich die Schweizer Finanzindustrie in einem fundamentalen Strukturwandel befindet. Neobanken, Kooperationen zwischen ihnen und etablierten Instituten sowie Marktplätze drücken auf die Margen. Weil für Bankkunden das Banking mit Fintechs und Technologiekonzernen nicht nur günstiger ist, sondern es ihnen auch mehr Spass macht, wird Kundenbindung für etablierte Finanzmarken zu allem Überfluss auch noch teurer. «Diese Entwicklungen werden dazu führen, dass traditionelle Institute vermehrt in ihre Vertriebskanäle sowie in innovative Angebote investieren müssen, nur um die steigenden Erwartungen zu erfüllen», so die Autoren der Studie.
Retail-Kunden: zufrieden und doch nicht loyal
Deutlich nehmen die Vertreter von hundert Banken Veränderungen im Zahlungsverkehr wahr: Führten im Vorjahr erst 47 Prozent der Befragten den Zahlungsverkehr als das am meisten vom Strukturwandel betroffene Geschäft an, waren es Ende 2019 bereits 63 Prozent. Zwar lässt sich damit nicht viel Geld verdienen, doch handelt es sich wegen der direkten Schnittstelle zum Kunden und zu den Transaktionsdaten um eine strategisch wichtige Funktion. Tatsächlich sind sich die Banken ihrer Kunden nicht mehr sicher. Knapp 80 Prozent fühlen sich durch branchenfremde Anbieter in ihrer Marktstellung bedroht. Dabei treiben neue Angebote schleichend einen Keil zwischen Kunde und Hausbank: Auch wenn die Kunden sehr zufrieden mit ihrer Bank sind, beziehen sie immer weniger Leistungen von dieser.
EY stellt fest, dass die Bankbeziehungen von Privatkunden über die Jahre zunehmend fragmentiert wurden: «Bankkunden nutzen für gewisse Produkte und Dienstleistungen bereits verschiedene Institute, die ihnen für das jeweilige Bedürfnis das beste Angebot präsentieren. Für den Zahlungsverkehr im Ausland wird das Angebot von Neobanken genutzt, um Gebühren bei Fremdwährungstransaktionen zu sparen, das Sparkonto liegt bei der Bank mit dem höchsten Zinssatz, die Hypothek wird beim Anbieter mit den günstigsten Hypothekarzinsen abgeschlossen, die Vorsorgeberatung bezieht der Bankkunde wiederum bei einem anderen Institut.»
Dreh- und Angelpunkt digitale Schnittstelle
So attraktiv es auch ist, sich individuelle Leistungspaket aus den jeweils besten Angeboten zusammenzuschnüren, einen Haken hat die Sache doch: Es wird zunehmend schwieriger, den Gesamtüberblick zu behalten und die Finanzen zu verwalten. Hier zahlen sich der gute Draht der Banken zu ihren Kunden und gewachsene Beziehungen aus. Mit Open Banking können die Finanzinstitute die Transaktionen mit verschiedenen Anbietern bündeln und vereinfachen. Auf diese Weise stärken sie ihre Position und binden die Kunden quasi über einen Umweg. Den Schweizer Branchenvertretern ist klar, dass sie in die Digitalisierung investieren müssen. Es zeichnet sich ab, dass die digitale Aufwertung des Frontends die Wettbewerbsposition schnell verbessert, zumal sich diese deutlich zügiger realisieren lässt als die Einführung neuer Kernbankensysteme. Eine offene, skalierbare Architektur garantiert einen Return on Investment innerhalb weniger Monate. So zahlt sich eine herausragende Customer Experience in guten Ergebnissen aus.